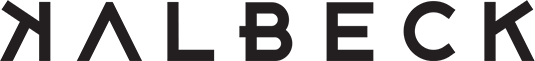IoT und die Selbstvermessung
Die hoffnungslose Suche nach dem Ich 2.0
Sich selbst zu vermessen liegt im Trend - doch nicht alles, was wir messen wollen, lässt sich messen; und nicht alles, was sich messen lässt, sollte gemessen werden. Ein Blick auf die Baustelle namens Quantified Self.
Noch 2.000 Schritte unter, dafür schon 400 Kilokalorien über dem täglichen Soll; statt dem Fernseher heute vielleicht das Fahrrad in Betrieb nehmen? Das schont auch gleich den Stromverbrauch, immerhin lag der in der Vorwoche viel niedriger.
Neben dem sich selbst befüllenden Kühlschrank ist das Selbsttracking wohl eines der ältesten Beispiele für den Einzug des Internet of Things in den menschlichen Alltag. Der Begriff “Quantified Self” wurde 2007 von zwei US-amerikanischen Journalisten des Wired-Magazins für eine gleichnamige Website eingesetzt und fand schon kurz darauf Anwendung beim Tracking des individuellen Ernährungsverhaltens passionierter Gruppen.
Mittlerweile gehören Sportler und Gesundheitsbewusste ebenso zum Bild der Quantified Self-Bewegung wie Unternehmer, kritische Selbstreflektierende und chronisch Kranke - gemessen wird, was gemessen werden kann. Und je mehr Geräte des täglichen Lebens miteinander kommunizieren können, desto vielschichtiger die Analyse.
Dabei balanciert das Tracking zwischen konstanter Selbstoptimierung mit fragwürdigem Potenzial einer Zieldefinition und der industriellen Nutzung durch die Generierung eines Mehrwerts aus der Bereitschaft des Menschen zur Preisgabe seiner Daten.
Die Neugier, sich selbst zu vermessen, zu analysieren und zu evaluieren ist nur zu verständlich. Der Mensch will sich selbst kennen und stetig verbessern, seine Ziele erreichen und sich neue stecken; ein Prozess, der als solcher zwar motivieren, aber nur schwer zufriedenstellen kann. Haben wir ein definiertes Ziel erreicht, wollen wir a) es beibehalten oder b) ein neues definieren. Beide Varianten laufen auf fortlaufendes Selbsttracking hinaus. Denn auch wer sein Ziel (z.B. Gewichtsreduktion) erreicht hat, befindet sich damit nur in einem punktuellen Zwischenresultat - damit das Gewicht nicht wieder steigt, ist konstante Beobachtung, Aktion und Reaktion notwendig. Ein Schlusspunkt lässt sich da nur schwer setzen.
Als Grundidee der “Quantified Self”-Bewegung wird oft die Selbstanalyse anhand quantifizierbarer Zahlen genannt. Einschätzungen und Entscheidungen trifft der Mensch zwar oft aus dem Bauch heraus, fühlt sich aber schon sehr viel sicherer, wenn sie durch Zahlen untermauert sind. Das trifft sowohl für den eigenen Körper als auch für den Haushalt und das Büro zu. Je individueller die Daten, desto genauer die Trackinganalyse. Oder?
Grundsätzlich orientieren sich wissenschaftliche und medizinische Studien an einer großen Anzahl an Probanden und Untersuchungsteilnehmern. Der einzelne Mensch kann dabei mit seinen Ergebnissen in den Standard- oder aber Ausnahmebereich fallen. Ein genaueres Resultat als jenes bei der Grundmenge n=1 gibt es wohl kaum. Schade nur, dass die Ergebnisse, die herangezogen werden, um Rückschlüsse auf die Aussagekraft von n=1 zu ziehen, immer noch von n=x kommen. Es mag also sein, dass mein Blutdruck nicht dem Optimalwert meiner Alters-, Gewichts- und Aktivitätsklasse entspricht - das heißt aber deswegen noch lange nicht, dass der Wert für mich persönlich schlecht ist.
Fast schon banal präsentieren sich die etablierten Fitnesstracker, die Gewicht und Größe des Sportlers mit Trainingsfrequenz und -dauer, Blutdruck und Puls zu einem Sammelsurium an Daten, Statistiken und Verlaufscharts hochrechnen. Viele Anbieter zeigen vergleichbare Funktionen - einzig das Design (und damit einhergehend auch oft der Preis) unterscheiden sich deutlich.
Fitbit beispielsweise bietet mittlerweile acht verschiedene, portable Tracking-Gadgets, die vom Gelegenheits-Spaziergänger bis zum Marathon-Wiederholungstäter jedes Klientel bedienen. Von Schritt- und Kalorienzähler über Schlaftracking bis hin zu kontinuierlicher Herzfrequenzmessung, SMS-Benachrichtigung und Musiksteuerung bleibt kein Wunsch unerfüllt.
Seine Wünsche selbst zu kennen ist bei der Fülle an Angeboten übrigens auch nicht mehr unbedingt notwendig. Denn wer hätte gewusst, dass die logische nächste Funktion einer Waage nach Gewicht, User Recognition, Fettanteil und Herzfrequenz die Messung der Luftqualität ist? Das Unternehmen Withings hat in den Smart Body Analyzer (der mittlerweile nur mehr über Amazon angeboten wird) genau deshalb einfach mal einen CO2-Sensor eingebaut. Logisch, oder?
Ebenfalls durchaus unkonventionell widmet sich HAPIfork dem gesunden Lebensstil; die Erfinder der smarten Gabel nehmen das Esstempo unter die Lupe und versprechen sich davon eine Verbesserung des individuellen Wohlbefindens und der Gesundheit. Dazu misst die Gabel beim Essen das Tempo, die Dauer und die Häufigkeit der einzelnen Mahlzeiten und schickt Warnungen, wenn zu schnell, zu oft oder zu viel gegessen wird. Worauf trotz des Slogans “Eat slowly, Lose weight. Feel great!” leider vergessen wurde, ist die Information, was denn eigentlich gegessen wird. Ob Salat, Schokotorte oder Steak - Hauptsache langsam wird gegessen.
Bei allem Potenzial des Komplexes “Internet of Things” finden sich oftmals ähnliche Anwendungen, Einsatzbereiche und Technologien. Einerseits verständlich, denn immerhin haben sich bestimmte Produktsysteme bewährt und etabliert - Nischenprodukte bergen oft mehr Risiko; andererseits aber auch schade, denn sinnhafte, durchdachte Usecases werden oftmals nicht umgesetzt,
Ad absurdum geführt wird diese Monotonie zusätzlich durch die Tatsache, dass nicht alles, was der Mensch messen will, sich auch so leicht quantifizieren lässt. Physische Merkmale (Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur, Schweißproduktion etc.) oder direkt messbare objektive Faktoren (Außentemperatur, Wasserstand, Kalorienmenge, Mineralstoffgehalt etc.) sind in ihrer Aussagekraft unmittelbar mit den jeweiligen Ausprägungen verknüpfbar. Um aber abstrakte Begriffe zu messen, reichen vereinzelte, vermeintlich aussagekräftige Faktoren nicht aus: wer viele Mails schreibt, ist nicht automatisch produktiv; wer viel schläft, ist nicht automatisch entspannt; und wer viele Facebook-Freunde hat, ist nicht automatisch ein umtriebiger Gesellschaftsmensch.
Wo die Selbstvermessung dann aber doch jemandem zugute kommt, ist überall dort, wo die Daten einem Anbieter dabei helfen, sein Angebot für die jeweilige Person maßzuschneidern oder Aussagen zu verifizieren, die Kosten oder Leistung beeinflussen. Die Datenschutz-Thematik soll hier gar nicht erst losgebrochen werden, reicht es doch schon aus zu erwähnen, dass etwa Versicherungsunternehmen ihre Kunden mittlerweile zwar motivieren, einen gesunden Lebensstil zu wählen und dadurch günstigere Tarife zu erhalten - doch welche Konsequenzen ein Nachlassen der Intensität oder eine Gewichtszunahme nach einigen Monaten oder Jahren haben, ist ein anderes Thema.
Was bleibt, ist die Frage nach dem Zusammenspiel von Möglichkeiten und Logik. Vieles wird gemessen - noch mehr will gewusst werden; doch nicht alles sollte gemessen und damit in ein digitales Etikett verwandelt werden; und nicht alles ergibt einfach so Sinn, nur weil man es technisch verknüpft.
Sich selbst auf der Spur
Neben dem sich selbst befüllenden Kühlschrank ist das Selbsttracking wohl eines der ältesten Beispiele für den Einzug des Internet of Things in den menschlichen Alltag. Der Begriff “Quantified Self” wurde 2007 von zwei US-amerikanischen Journalisten des Wired-Magazins für eine gleichnamige Website eingesetzt und fand schon kurz darauf Anwendung beim Tracking des individuellen Ernährungsverhaltens passionierter Gruppen.
Erfasste Daten liefern einen subjektiven Mehrwert für den Nutzer, der dabei oft bereitwillig und unerkannt seine Daten der industriellen Verarbeitung preisgibt.
Mittlerweile gehören Sportler und Gesundheitsbewusste ebenso zum Bild der Quantified Self-Bewegung wie Unternehmer, kritische Selbstreflektierende und chronisch Kranke - gemessen wird, was gemessen werden kann. Und je mehr Geräte des täglichen Lebens miteinander kommunizieren können, desto vielschichtiger die Analyse.
Dabei balanciert das Tracking zwischen konstanter Selbstoptimierung mit fragwürdigem Potenzial einer Zieldefinition und der industriellen Nutzung durch die Generierung eines Mehrwerts aus der Bereitschaft des Menschen zur Preisgabe seiner Daten.
Das Ziel ist der Weg
Die Neugier, sich selbst zu vermessen, zu analysieren und zu evaluieren ist nur zu verständlich. Der Mensch will sich selbst kennen und stetig verbessern, seine Ziele erreichen und sich neue stecken; ein Prozess, der als solcher zwar motivieren, aber nur schwer zufriedenstellen kann. Haben wir ein definiertes Ziel erreicht, wollen wir a) es beibehalten oder b) ein neues definieren. Beide Varianten laufen auf fortlaufendes Selbsttracking hinaus. Denn auch wer sein Ziel (z.B. Gewichtsreduktion) erreicht hat, befindet sich damit nur in einem punktuellen Zwischenresultat - damit das Gewicht nicht wieder steigt, ist konstante Beobachtung, Aktion und Reaktion notwendig. Ein Schlusspunkt lässt sich da nur schwer setzen.
Die Wissenschaft der Zahlen
Auch wer seine eigene Statistik ist, kann eine statistische Abweichung sein.
Als Grundidee der “Quantified Self”-Bewegung wird oft die Selbstanalyse anhand quantifizierbarer Zahlen genannt. Einschätzungen und Entscheidungen trifft der Mensch zwar oft aus dem Bauch heraus, fühlt sich aber schon sehr viel sicherer, wenn sie durch Zahlen untermauert sind. Das trifft sowohl für den eigenen Körper als auch für den Haushalt und das Büro zu. Je individueller die Daten, desto genauer die Trackinganalyse. Oder?
Grundsätzlich orientieren sich wissenschaftliche und medizinische Studien an einer großen Anzahl an Probanden und Untersuchungsteilnehmern. Der einzelne Mensch kann dabei mit seinen Ergebnissen in den Standard- oder aber Ausnahmebereich fallen. Ein genaueres Resultat als jenes bei der Grundmenge n=1 gibt es wohl kaum. Schade nur, dass die Ergebnisse, die herangezogen werden, um Rückschlüsse auf die Aussagekraft von n=1 zu ziehen, immer noch von n=x kommen. Es mag also sein, dass mein Blutdruck nicht dem Optimalwert meiner Alters-, Gewichts- und Aktivitätsklasse entspricht - das heißt aber deswegen noch lange nicht, dass der Wert für mich persönlich schlecht ist.
Auf zum Self Improvement
Fast schon banal präsentieren sich die etablierten Fitnesstracker, die Gewicht und Größe des Sportlers mit Trainingsfrequenz und -dauer, Blutdruck und Puls zu einem Sammelsurium an Daten, Statistiken und Verlaufscharts hochrechnen. Viele Anbieter zeigen vergleichbare Funktionen - einzig das Design (und damit einhergehend auch oft der Preis) unterscheiden sich deutlich.
Fitbit beispielsweise bietet mittlerweile acht verschiedene, portable Tracking-Gadgets, die vom Gelegenheits-Spaziergänger bis zum Marathon-Wiederholungstäter jedes Klientel bedienen. Von Schritt- und Kalorienzähler über Schlaftracking bis hin zu kontinuierlicher Herzfrequenzmessung, SMS-Benachrichtigung und Musiksteuerung bleibt kein Wunsch unerfüllt.
Seine Wünsche selbst zu kennen ist bei der Fülle an Angeboten übrigens auch nicht mehr unbedingt notwendig. Denn wer hätte gewusst, dass die logische nächste Funktion einer Waage nach Gewicht, User Recognition, Fettanteil und Herzfrequenz die Messung der Luftqualität ist? Das Unternehmen Withings hat in den Smart Body Analyzer (der mittlerweile nur mehr über Amazon angeboten wird) genau deshalb einfach mal einen CO2-Sensor eingebaut. Logisch, oder?
Ebenfalls durchaus unkonventionell widmet sich HAPIfork dem gesunden Lebensstil; die Erfinder der smarten Gabel nehmen das Esstempo unter die Lupe und versprechen sich davon eine Verbesserung des individuellen Wohlbefindens und der Gesundheit. Dazu misst die Gabel beim Essen das Tempo, die Dauer und die Häufigkeit der einzelnen Mahlzeiten und schickt Warnungen, wenn zu schnell, zu oft oder zu viel gegessen wird. Worauf trotz des Slogans “Eat slowly, Lose weight. Feel great!” leider vergessen wurde, ist die Information, was denn eigentlich gegessen wird. Ob Salat, Schokotorte oder Steak - Hauptsache langsam wird gegessen.
Das Vermessen um des Vermessens Willen
Bei allem Potenzial des Komplexes “Internet of Things” finden sich oftmals ähnliche Anwendungen, Einsatzbereiche und Technologien. Einerseits verständlich, denn immerhin haben sich bestimmte Produktsysteme bewährt und etabliert - Nischenprodukte bergen oft mehr Risiko; andererseits aber auch schade, denn sinnhafte, durchdachte Usecases werden oftmals nicht umgesetzt,
Ohne entsprechende Logik und Verknüpfung bleibt die Quantität von Faktor A oft einfach nur die Quantität von Faktor A.
Ad absurdum geführt wird diese Monotonie zusätzlich durch die Tatsache, dass nicht alles, was der Mensch messen will, sich auch so leicht quantifizieren lässt. Physische Merkmale (Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur, Schweißproduktion etc.) oder direkt messbare objektive Faktoren (Außentemperatur, Wasserstand, Kalorienmenge, Mineralstoffgehalt etc.) sind in ihrer Aussagekraft unmittelbar mit den jeweiligen Ausprägungen verknüpfbar. Um aber abstrakte Begriffe zu messen, reichen vereinzelte, vermeintlich aussagekräftige Faktoren nicht aus: wer viele Mails schreibt, ist nicht automatisch produktiv; wer viel schläft, ist nicht automatisch entspannt; und wer viele Facebook-Freunde hat, ist nicht automatisch ein umtriebiger Gesellschaftsmensch.
Wo die Selbstvermessung dann aber doch jemandem zugute kommt, ist überall dort, wo die Daten einem Anbieter dabei helfen, sein Angebot für die jeweilige Person maßzuschneidern oder Aussagen zu verifizieren, die Kosten oder Leistung beeinflussen. Die Datenschutz-Thematik soll hier gar nicht erst losgebrochen werden, reicht es doch schon aus zu erwähnen, dass etwa Versicherungsunternehmen ihre Kunden mittlerweile zwar motivieren, einen gesunden Lebensstil zu wählen und dadurch günstigere Tarife zu erhalten - doch welche Konsequenzen ein Nachlassen der Intensität oder eine Gewichtszunahme nach einigen Monaten oder Jahren haben, ist ein anderes Thema.
Was bleibt, ist die Frage nach dem Zusammenspiel von Möglichkeiten und Logik. Vieles wird gemessen - noch mehr will gewusst werden; doch nicht alles sollte gemessen und damit in ein digitales Etikett verwandelt werden; und nicht alles ergibt einfach so Sinn, nur weil man es technisch verknüpft.